Kollaborationswerkzeuge sind im heutigen Studium Alltag unablässig. Wenn mehrere Personen an einer Arbeit beteiligt sind, vereinfachen Social Collaboration Werkzeuge wie Dropbox oder OneDrive die gemeinsame und vernetzte Zusammenarbeit. Über diese Plattformen wird die Kommunikation erheblich erleichtert und ein speditiver Arbeitsstil geschaffen. Im Studium der Sozialen Arbeit werden sie beispielsweise für die Arbeit an Praxisprojekten in Form von Microsoft Teams genutzt, damit alle Teilnehmenden Personen Zugriff auf relevante Dokumente haben. Der Zugriff ermöglicht eine gemeinsame Bearbeitung an Dokumenten und verhindert ein lästiges hin und her senden von Dokumenten per Mail. So können vor allem Fehlerquellen verringert werden. Inhalte können in solchen Social Collaboration Tools nicht nur geteilt werden, auch private Dokumente können gesichert werden. Der Zugriff auf Dokumente wird so von unterschiedlichen Geräten aus ermöglicht, wodurch flexibles Arbeiten erleichtert wird. Damit ein solcher Wissensaustausch erreicht werden kann wird vorausgesetzt, dass man nicht nur Informationen konsumiert, sondern auch teilt. Nur so 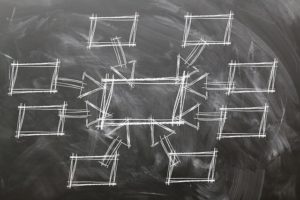 kann das System weitergeführt werden. Beispielsweise Wikipedia kann nur dann funktionieren, wenn interessierte Personen Einträge über Themen schreiben.
kann das System weitergeführt werden. Beispielsweise Wikipedia kann nur dann funktionieren, wenn interessierte Personen Einträge über Themen schreiben.
Für Mitglieder von Organisationen haben Social Collaboration den Vorteil, dass sie Dokumente relativ autonom benutzen können. In einer sozialen Organisation, in der ich gearbeitet habe, wurde das Programm RedLine für die Zusammenarbeit genutzt. Das Programm kann sowohl von Mitarbeitern, als auch von Klienten genutzt werden. Die Einbindung von Klienten in die Organisation kann so gefördert werden und für Mitarbeiter erreicht man die Vereinfachung von administrativen Arbeiten. Auch der Zugriff auf Relevante standardisierte Dokumente kann von verschiedenen Standorten geschehen.
Spätestens seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention BRK im Jahr 2006, sollten in sozialen Organisationen der Schweiz Menschen mit einer Beeinträchtigung möglichst selbstbestimmt und selbstständig leben können. (vgl. INSOS, 2018) Ein konkretes Instrument dazu, kann aus meiner Sicht in Social Collaboration Programmen bestehen. Gewisse Einträge können in Zusammenarbeit mit Klienten erstellt werden und oder aus Seiten der Klientel einsehbar sein. Diese Form von Kommunikation bringt wiederum Herausforderungen mit sich, denn Kompetenzen zur Nutzung müssen von Klientel und Mitarbeitern gelernt und Chancen und Risiken erkannt werden. Um sich einen Überblick über Chancen und Risiken und die Anwendung von Social Collaboration Tools oder allgemein zu Social Media in Bezug zur Sozialen Arbeit zu verschaffen, bietet Sozialinfo.ch einen Leitfaden an.
Literaturverzeichnis
INSOS. (2018). Aktionsplan UN-BRK. Gefunden am 19.11.2018 unter https://www.insos.ch/politik/aktionsplan-un-brk/
