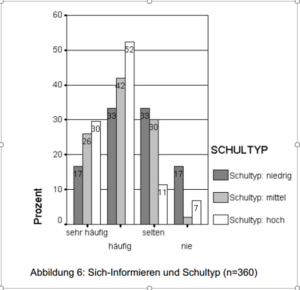Die Studie «Digitale Ungleichheit und formaler Bildungshintergrund – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über Nutzungsdifferenzen von Jugendlichen im Internet» zeigt die Ergebnisse einer Befragung von 360 Personen im Rahmen der der deutschen Bundesinitiative «Jugend ans Netz». Ziel der Initiative ist es, «durch eine Ausstattungsinitiative sowie die Entwicklung eines Jugendportals [zu] ermöglichen, dass allen Jugendlichen den Zugang zu Informationen sowie Bildungs-, Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten» gesichert wird (Iske u.a. 2004, S. 3). Die Jugendlichen nahmen mittels eines Fragebogens teil. Ziel war die Untersuchung Digitaler Ungleichheit („Digital Inequality“) im Umgang und in der Nutzung des Internet durch unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichem formalem Bildungsstand.
«Ausgehend von der Hypothese Bourdieus (1986), dass soziales und kulturelles Kapital im „real life“ Auswirkungen auf Sozial-. Bildungs- und Beteiligungsstrukturen im virtuellen Raum haben, wurde bei der Auswertung der Daten insbesondere der formale Bildungshintergrund der Befragten berücksichtigt» (Iske u.a. 2004, S. 6). Dazu wurden die von den beteiligten Jugendlichen besuchten Schulen, bzw. gemachten Bildungsabschlüsse mit einbezogen. Die Variable „Bildung“ wurde aus dem „derzeit besuchten Schultyp“ bzw. dem höchsten erreichten „Schulabschluss“ errechnet. Demzufolge haben 26% der Befragten einen formal niedrigen Bildungshintergrund, 43% einen formal mittleren Bildungshintergrund und 31% einen formal hohen Bildungshintergrund (Iske u.a. 2004, S. 6).
In der Studie wurden folgende Fragen im Detail untersucht:
- – Nutzungsveränderungen im Laufe der Zeit
- – Kontaktaufnahme/ Anmeldung zu/ bei einer Internetseite
- – Inhaltlicher Nutzen durch gezieltes Suchen
- – Beurteilung von Qualität von Internetseiten
- – Zugangsorten zum Internet
Zusammenfassend zeigt sich, dass Nutzungsdifferenzen entlang der Bildungsvariablen in allen Fragen feststellbar waren. „Es ist also festzuhalten, dass die Möglichkeiten der Internetnutzung stark mit den Ausgangsbedingungen der Nutzer*innen und deren sozialem Kontext im „real life“ zusammenhängen (vgl. unterschiedliche Formen von Kapital bei Bourdieu, 1986). Nutzung, Beteiligung und Bildungsprozesse ergeben sich nicht zwangsläufig durch ein vorliegendes, zur Verfügung stehendes Angebot, sondern erfordern eine entsprechende Berücksichtigung der unterschiedlichen Ressourcen von jugendlichen Nutzern“ (Iske u.a. 2004, S. 23).
Die Studie zeigte auch, dass das Internet und die sozialen Medien einen klaren Mehrwert darstellen, sei es bei Kontakten, Information oder Beteiligung und die sich daraus ergebenen Chancen und Möglichkeiten. Die Nutzung der verschiedenen Internet Dienste wurde von den Befragten wie folgt angegeben: Nutzung verschiedener Internet-Dienste kumulierte Prozente der Antworten
„sehr häufig“ und „häufig“
Gezielt nach Informationen suchen 72,7%
Emails verschicken 58,9%
Musik downloaden 46,5%
Seiten mit Anmeldung 46,1%
Chatten 45,9%
Musik hören 33,1%
Filme downloaden 30,8%
Online-Spiele spielen 30,2%
anderes downloaden 29,4%
Versteigerungen 29,1%
SMS verschicken 28,8%
ICQ 26,5%
Ungezielt nach Informationen suchen 21,1%
Klingeltöne / Logos für Handy 18,7%
Filme ansehen 16,3%
Online-Shopping 16,3%
Instant Messenger 13,8%
An Diskussionsforen teilnehmen 13,1%
IRC 11,6%
Tauschen 10,3%
Tabelle 2: Nutzung bestimmter Internet-Dienste (n=360)
Auch die Autorin Ulrike Wagner kommt in ihrem Beitrag «Die Rolle des Internets zur Aneignung gesellschaftlich relevanter Informationen» zu folgendem Erkenntnis: «Bildungsspezifische Unterschiede lassen sich u. a. dahingehend konstatieren, dass Befragte mit niedriger formaler Bildung vermehrt kommunikativ geprägte sowie audiovisuelle Angebote nutzen, um sich über das sie interessierende Thema zu informieren» (Wagner 2014, S. 176).
Diese Tabelle zeigt die Nutzung verschiedener sozialer Medien, um sich über das ausgewählte Thema zu informieren, im Vergleich von verschiedenen Bildungsgraden (Angaben in Prozent, N = 1182). Aus: (Wagner 2014, S. 176)
| Webchats | Täglich/ mehrmals wöchentlich | Ein- bis viermal pro Monat | Seltener als einmal im Monat |
| Niedrige Bildung | 10% | 9.2% | 8.4% |
| Höhere Bildung | 5.2% | 4.7% | 8.7% |
| Netzwerke/ Communitys | Täglich/ mehrmals wöchentlich | Ein- bis viermal pro Monat | Seltener als einmal im Monat |
| Niedrige Bildung | 46.6% | 16.1% | 11.6% |
| Höhere Bildung | 36.2% | 15.8% | 14.8% |
| Videos/ Hörbeiträge | Täglich/ mehrmals wöchentlich | Ein- bis viermal pro Monat | Seltener als einmal im Monat |
| Niedrige Bildung | 29.0% | 20.1% | 14.1% |
| Höhere Bildung | 23.3% | 16.4% | 19.5% |
In ihrem Fazit kommt Wagner zu dem Schluss, dass Online Beteiligungsformen eine niederschwellige Möglichkeit darstellen, um partizipativ handeln zu können. Die Art und Weise, wie diese Beteiligung mit und über Medien realisiert wird, ist nach wie vor abhängig von den lebensweltlichen Ressourcen und den Ressourcen, die über das Medienhandeln selbst erworben werden, bzw. dort zur Verfügung stehen. (vgl. Wagner 2014, S. 183).
Anhand des Beispiels der Social Media Plattform YouTube hat sich meine persönliche Nutzung durch die Aufnahme des Studiums der Sozialen Arbeit stark verändert. Habe ich es vorher in der Hauptsache für Anleitungen bei kreativen Freizeitarbeiten benutzt, schaue ich jetzt v. a. Dokumentationen über das Thema Suchtmittelabhängigkeit und psychische Erkrankungen und lasse mir Theorien der Sozialen Arbeit und der Soziologie via Filmbeiträgen erklären. Im Weiteren nutze ich Informationsplattformen wie Google und Wiki verstärkt, um wissenschaftliche Literatur zu den Studienthemen zu suchen und um mich vorab über diese Themen allgemein zu informieren. Im Zusammenhang mit diesen Blogbeiträgen habe ich meine Kinder zu ihrer Internet Nutzung befragt. Meine Tochter besucht die 1. Klasse der Kantonsschule SG und hat ihre Nutzung in absteigender Reihenfolge wie folgt genannt: Manga Tube und ähnliche Plattformen zum Lesen und Schauen von Mangas in englischer Sprache, Pinterest, Snapchat. Sie hat bewusst kein Facebook Profil, wie ich übrigens auch nicht. In der Unterhaltung haben wir festgestellt, dass wir beide die Zeit dafür nicht aufwenden können und wollen; bei mir kommt noch meine Haltung dazu, dass ich mein Privatleben auch privat behalten möchte. Mein Sohn, der im letzten KV Lehrjahr ist, streamt ausschliesslich Filme von allen möglichen Anbietern und spielt online Actionspiele. En passant liest er die täglichen Nachrichten, aber v. a. durch die Überschriften/ Zusammenfassung und oberflächlich. Bei den täglichen gemeinsamen Mahlzeiten zeigt sich in den Diskussionen, dass er zwar irgendetwas zu einem Thema gehört hat, aber Fakten und Zahlen oft falsch wiedergibt (oberflächliche Wahrnehmung).
Die Aussagen über das persönliche Nutzungsverhalten von Social Media Plattformen meiner Kernfamilie sind natürlich nur Schlaglichter. Ich selber kann bestätigen, dass ich das Internet überhaupt sehr viel stärker nutze als vor dem Studium und dass ich zwischen meinem Sohn und meiner Tochter sehr wohl unterschiedliche Nutzungsverhalten sehen kann, die ich auf das unterschiedliche Bildungsniveau, aber auch auf geschlechterspezifische Unterschiede zurückführe.